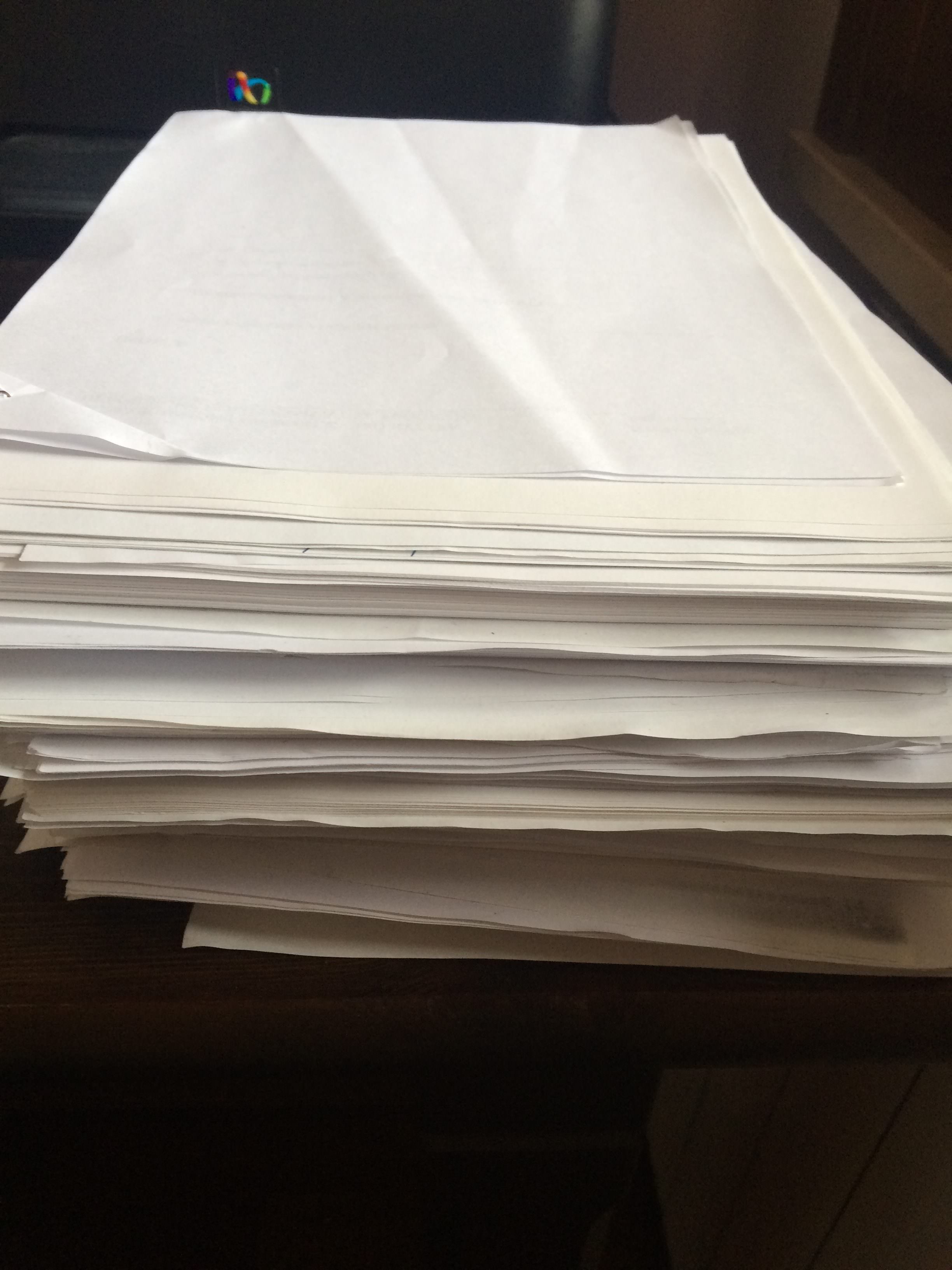Nur wenig Dinge im Leben sind verlockender als ein frisches Brot/Baguette oder gekochter Schinken aus Italien. Und deshalb gelingt es mir fast niemals, von einem frisch gekauften Brot oder eben Baguette nicht sofort ein Stück abzunagen. Früher war ich der Schreck meiner Mutter, wenn ich ausgehöhlte Brote vom Bäcker mit nach Hause gebracht habe. Heute der meines Mannes, der es unpassend findet, dem Baguette noch im Geschäft oder auf der Straße den Po abzunagen. Ihm zuliebe beherrsche ich mich bis nach der Kasse. Denn normalerweise nehme ich es und breche ein Stück ab. Schlimm. Das mit dem Schinken in Italien ist hingegen ein Kindheitsversprechen an mich selbst. Früher, wenn wir unsere Ferien in Italien verbracht haben, gab es einen kleinen „Despar“, bei dem man schon auch mal Bonbons rausbekommen hat, wenn kein Kleingeld in der Kasse war oder es sich um so piepkleine Beträge gehandelt hat, die beim besten Willen nicht mehr monetarisierbar waren. Dort haben wir unsere größeren und kleineren Einkäufe erledigt. Und neben massig Schokolade und Ovomaltine für meinen unterernährten Vater, gab es auch immer den herrlichen gekochten Schinken, der in Italien so ganz anders schmeckte und immer noch schmeckt als in Deutschland.
Schon der Kauf war außerordentlich aufregend. Die Maschinen viel größer und auch die Verpackung. Die Ware wurde in Waschspalier eingewickelt, der Preis mit dickem schwarzen Filzstift auf das hellbraune Papier geschrieben und dann thronte er duftend in unserem Kühlschrank. Hauchdünn war er geschnitten und herrlich trocken (ich mag außer bei Fleisch fast gar nichts Saftiges, vielleicht noch bei Zwetschgendatschi, aber keinesfalls bei Garnelen oder Fisch!!!). Und er sollte die Quelle einer großen Sehnsucht werden. Er war nämlich für den Papa. Man konnte schon mal eine Scheibe haben, aber nicht die Mengen, die ich gerne gehabt hätte. Und damals vor dem kleinen Kühlschrank in der Küche mit dem Vorhang habe ich mir geschworen: wenn ich mal groß bin, kaufe ich mir gekochten italienischen Schinken, so viel ich will. Und esse ihn ohne Brot. Morgens, mittags und abends. Nun muss man wissen, es gab bei uns vernünftigerweise auch keine Cola oder Fanta oder so einen Kram. Aber das war mir relativ egal. Der Schinken war und ist bis heute hingegen eine große Freude für mich und mein Metzger in Rom weiß ganz genau, dass es keine gute Idee ist, ihn erstens zu dick zu schneiden und mit zweitens nicht probieren zu lassen.
Nun bin ich sicherlich mit solchen Kindheitserinnerungen oder -sehnsüchten gut dran und kann sie relativ harmlos im Leben ausleben (natürlich hilft es, dass ich regelmäßig in Italien bin, wer weiß, welch schlimme Störung sich sonst in mir breit gemacht hätte), aber was ist mit all den Menschen, denen (noch) Wichtigeres als dieser Schinken gefehlt hat? Neulich habe ich in der Mediathek einen Zweiteiler über den zweiten Weltkrieg gesehen und dass damals Kinder nach England verschickt wurden. Sie lebten dort bei fremden Familien – über Jahre hinweg – und sollten dann wieder zurück zu ihren eigenen (traumatisierten) Eltern. Wie soll das gehen? Und wie kann es sein, dass unsere Wohlstandskinder heute beinahe verstörter, dicker und lebensunfähiger im Sinne von sozial auffällig sind als diese Kinder? Fehlt ihnen das Korsett der Disziplin, an dem sie sich halten können? Ich für meinen (kindheitserinnernden) Teil freue mich jedenfalls sehr, dass ich momentan zwar noch in Paris, morgen aber bereits in Rom sein werde und als eine der ersten Taten mindestens 200 Gramm gekochten Schinken ordern werde. Wieviel davon nach Hause kommt, steht auf einem anderen Blatt.