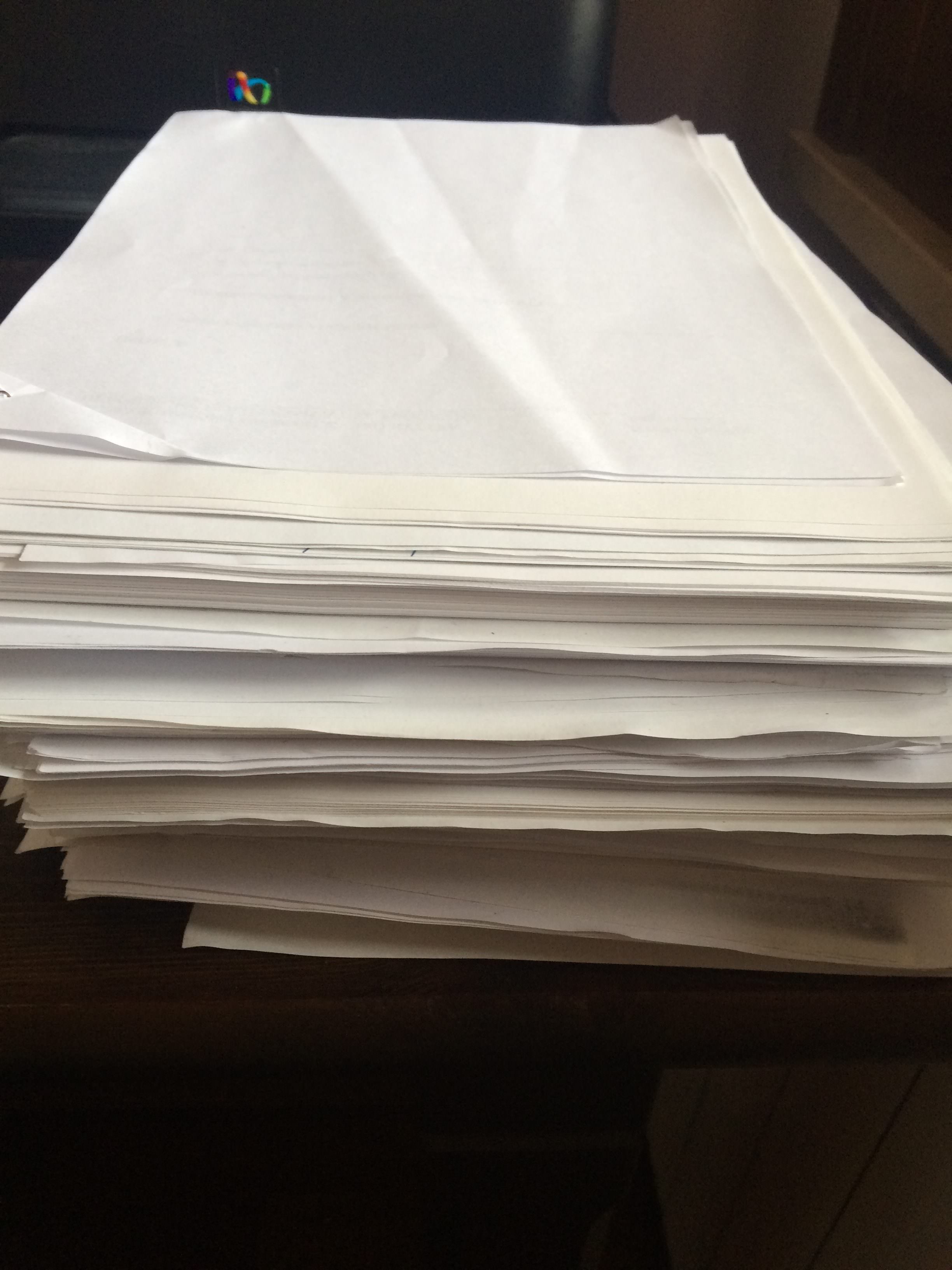Für all Diejenigen, die es noch nicht wissen: möchte man es drauf anlegen, mich richtig und nachhaltig zu verärgern, genügt es, mir ein hartes, hohes Kissen – am besten gleich zwei – zu geben. Soll ich auf einem solchen Hochhaus schlafen, ziehe ich es vor, mir einen Schal oder ein Handtuch unter mein Haupt zu schieben. Und bin verärgert. In den meisten Hotels bleibt mir auch nichts anderes übrig als verärgert meinen besten Kaschmirschal zu verrammeln (auf die Idee, mit Kopfkissen zu verreisen, wie es wohl einige Menschen tun, bin ich noch nicht gekommen, muss ich zugeben, ist aber wirklich eine Überlegung, jetzt, wo ich so drüber schreibe…..), nicht so heute. Während einer anderen Hotelroutine, nämlich dem Verstauen sämtlicher Menüs, Hotelinformationen, Bibeln, und Aufsteller, die meiner Meinung nach überhaupt gar nichts an einem Ort zu suchen haben, an dem man sich „wie zuhause“ fühlen soll, habe ich interessehalber einen Blick auf den Plexiglasaufsteller auf meinem Nachtisch geworfen. Denn ganz ehrlich: was soll da drauf stehen? Im Bad ok, da erfährt man, dass zwar gerne alle zwei Stunden die Handtücher gewechselt werden, man von Hotelseite aber doch auch bitte gerne seinen Beitrag zum Umweltschutz leisten würde. Das ist verständlich und vertraut, was aber kann neben dem Bett an Information (von Hotelseite) stehen?
Dort steht, dass man liebend gerne auf die Wünsche der geschätzten Gäste eingehen möchte und die unterschiedlichsten Bettwaren bereit hält. Also habe ich meinen Mann gebeten, mir doch bitte ein weiches, knautschbares Kuschelkissen, unter dem ich nicht ersticke und das ich mir in den Nacken bollen kann, zu bestellen. Er mag es nicht gerne, wenn man etwas anders möchte, als es vorgesehen ist. Außer bei Wohnungen und Ampeln. Da liebt er es geradezu, Wände und Farben bestenfalls als erste Vorschläge zu betrachten und sie ganz nach eigenem Gusto zu interpretieren. Nach ein paar kleinen Wiederholungen hat er dann dennoch bei der Rezeption angerufen (er spricht einfach so viel besser Italienisch als ich) und hat nach einem anderen Kissen gefragt. Und dann war er baff. Er wurde nämlich gefragt, welche Art von Kissen aus dem „menu dei cuscini“ er denn wohl gerne hätte. Sprachlos war er. Ich konnte ihm das Menu sehr triumphierend reichen und auf das weiche Daunenkissen deuten. Ich finde nämlich, wenn man schon so einen Service anbietet, dann freut man sich doch auch, wenn er genutzt wird. Das ist doch, wie wenn ich mordsviele Gerichte auf ein Buffet stelle und die Gäste dann ein Butterbrot essen. Viel netter ist es, wenn sie fragen, ob noch was von dem Kichererbsenauflauf da ist.
Nun liege ich also auf einem daunenweichen Kissen, freue mich, dass ich kein bisschen allergisch mehr bin und arbeite immer noch die Pasta vom Mittag ab. Zwischendurch höre ich drohendes Hupen von der Hauptstraße, auf der sich andauernd tankergroße Reisebusse aneinander vorbeiquetschen, Motorini sich todesmutig an ihnen und vor allem auch zwischen ihnen entlang fädeln und überlege, ob ich heute tatsächlich nochmal aufstehe. Die Daunen halten mich förmlich gefangen, der Ab- und vor allem der Wiederaufstieg hier in Positano ist steil und ich bin schrecklich müde. Es wäre doch zu schade, würde ich mein Wunschkissen nicht erst mal ausgiebig testen oder? Es wäre geradezu unhöflich…..tssssss.