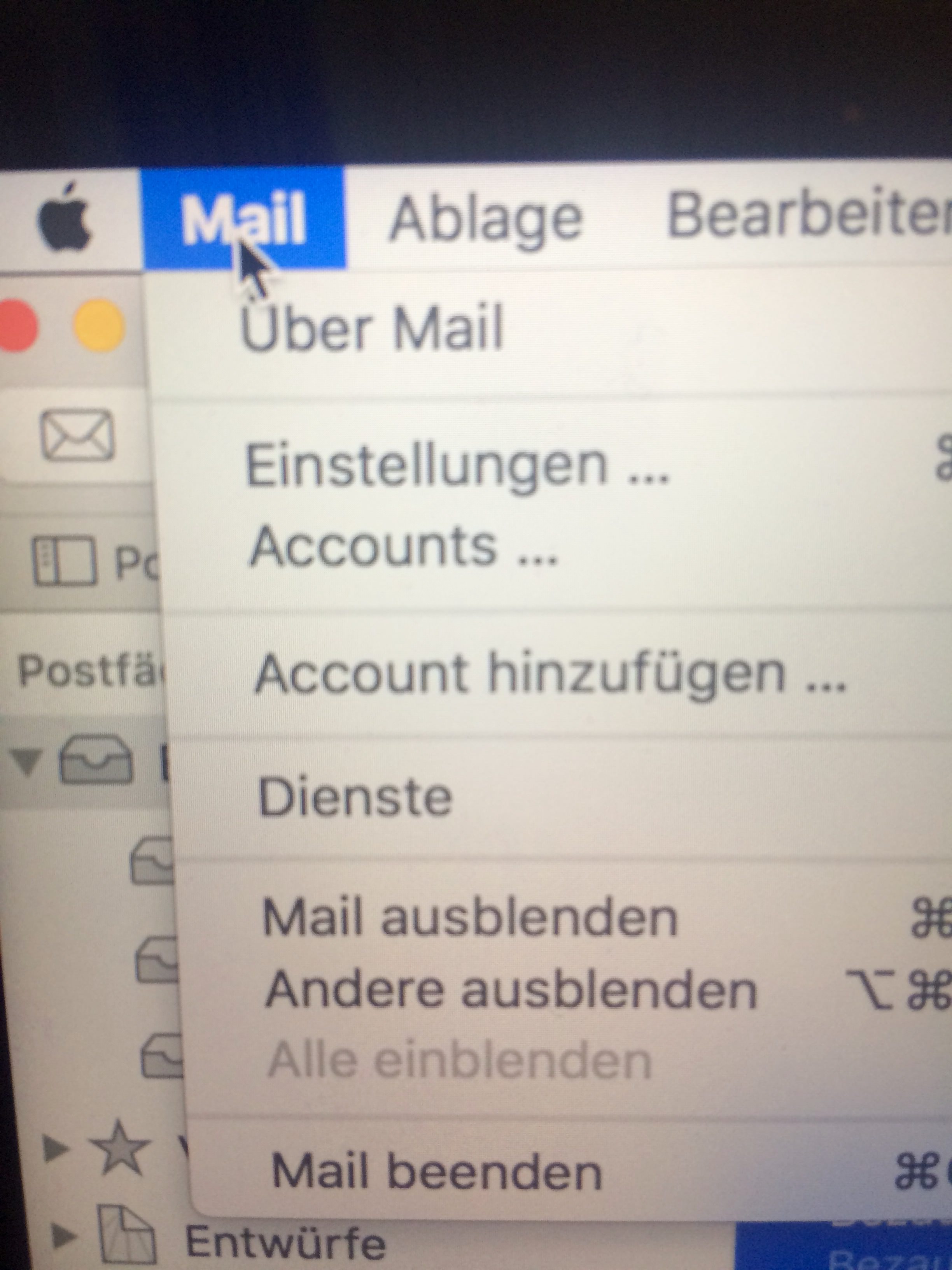Für alle Zuhause- bzw. Noch-Zuhause-Gebliebenen: Es ist in Rom kein bisschen warm und grauen Wolken hängen über der Stadt, was mich sehr empört und verängstigt, weil ich mein Auto als Erstes gewaschen habe, wie ich das übrigens in Rom immer tue. Es steht während meiner Abwesenheit so treu und brav in der Garage, wird eingestaubt und respektlos von Katzen besetzt, da ist es das Mindeste, was ich tun kann bei meiner Rückkehr. Trotz der deutschen Wetterverhältnisse und Gewohnheiten haben wir sofort bemerkt, dass wir wieder in Italien sind. Denn in Rom ist Taxistreik. Und das seit fünf Tagen. „Uber“ und vor allem „Uber Pop“ sind die Steine des Anstoßes. Das ist verständlich. Zumindest aus Sicht der Taxifahrer, die teilweise jahrelang ihre Lizenzen und Konzessionen abbezahlen, mit denen ein recht übler Handel getrieben wird. Angeblich vergibt die Stadt zu wenige. Und die, die vergeben sind, streiken recht oft. Dass sich dort – ebenso wie in Paris – ein privates und flexibles Unternehmen prima hineinschlängeln kann, liegt auf der Hand. Unser höchsteigener Tassista, der liebe Berardo teilte mir all dies bereits per WhatsApp mit, als ich ihm unsere Ankunftszeit mitteilte.
Und so kam er dieses Mal nicht als Taxifahrer, sondern als sehr guter Freund der Familie im Auto seiner Tochter. Und welch Glück, dass er seine Tochter vergöttert und verwöhnt. Deshalb konnten wir mit unserem nicht unerheblichen Gepäck in einem Einser BMW Platz nehmen. Mein Vater war kein Taxifahrer und ich auch Einzelkind, aber mein erstes Auto war der Uralt-Golf von meiner Oma und den musste ich ihr auch noch abkaufen. Das ist jedoch ein anderes Thema und soll hier nicht weiter behandelt werden. Im Hinterkopf kann man es ja mal behalten. Berardo (so heißt er und nach über fünfzehn Jahren bin ich mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob das sein Vor- oder Nachnamen ist) stand also bei den Abflügen, weil man ihn bei der Ankunft erkennen und gegebenenfalls lynchen würde. Als er uns ratlos suchend sah, ist er aus dem Auto gesprungen und wir sind wie zwei Verliebte aufeinanderzugeeilt, weil auch noch die Polizei und Teile des italienischen Militärs um uns herumstanden. Damit es noch glaubwürdiger wird, hat er auch noch meine Mutter sehr geschmust und uns fürsorglich Stück für Stück in den deutschen Kleinwagen geschichtet.
Heute dann, als wir für meine Mutter endlich eine Handtasche gekauft haben, durften wir erneut feststellen, was für ein zauberhaftes und engagiertes Land dieses Italien doch ist. Kaum mit dem Taxi an der Spanischen Treppe angekommen, sind wir in das Geschäft ihres Vertrauens, besser gesagt ihrer Sehnsüchte gestürmt und haben dort einer verdatterten Verkäuferin in Rekordzeit eine Handtasche abgekauft. Sie spricht vermutlich jetzt immer noch darüber, welche tollen Modelle es gibt und dass um drei Uhr in Mailand die Herbst/Winterkollektion vorgestellt wird. Wir bekamen Espresso und Wasser und nach einer halben Stunde haben wir uns auch schon wie zuhause gefühlt. Aus Ermattung und Resignation hab ich mich dann auf die Treppen gesetzt – mein Mutter hat da mehr Contenance und ist stur wie ein Sägebock an der Kasse stehengeblieben – und habe begonnen, mir meine Gedanken über den Durchlauf in solchen Geschäften zu machen und wie oft mein Mann dort vernünftigerweise einkaufen würde, wenn der Bezahlvoqrgang zwanzig Mal so lang dauert wie das Auswählen. Dann kam die Lösung: Es war keine passende Schachtel aufzutreiben, der Po der Tasche, so wurde mir erklärt, sei zu sperrig und passte in jede Schachtel in letzter Sekunde dann doch nicht hinein. Nun, welche Frau kennt dieses Problem nicht? Man habe jetzt jemanden in ein anderes Geschäft geschickt, um eine Schachtel holen zu lassen. Und das hat nun eben gedauert. Es ist und bleibt ein hinreißendes Land dieses Italien.